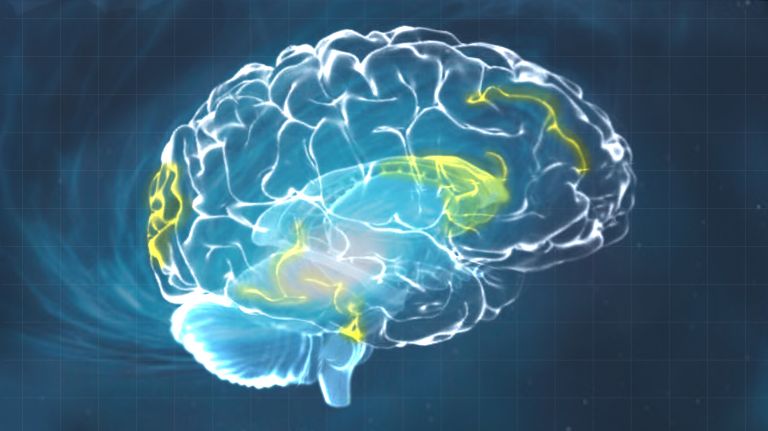Was macht ein Genie aus?

Die Frage – Gene oder Umwelt – war gestern: Um ein herausragendes Talent für Kunst, Sport oder Wissenschaft zu entwickeln, muss vieles zusammenkommen. Aber was?
Scientific support: Prof. Dr. Robert Gaschler
Published: 01.10.2017
Difficulty: easy
- Seit 150 Jahren herrscht ein erbitterter Streit – basiert Genialität, Talent auf den Anlagen oder dem Einfluss der Umwelt? Vor mehr als 20 Jahren stellten Forscher eine steile These auf. Ein wahrer Meister in Musik, Kunst oder Sport werde man nicht durch Talent, sondern durch mindestens 10.000 Übungsstunden.
- Neuere Studien zeigen allerdings, dass Üben wohl nicht einmal die halbe Miete auf dem Weg zum Expertentum ist.
- Eine weitere wichtige Komponente ist die Intelligenz, die bis zu einem guten Teil eine Sache der Vererbung ist. Angeborene Begabung ist für außerordentliche Leistungen also nicht gerade unwichtig.
- Auch Persönlichkeitseigenschaften wie Neugier und Motivation spielen eine Rolle bei großen Leistungen.
- Aus heutiger Sicht ist der Streit um Anlage oder Umwelt eigentlich sinnlos. Beide greifen eng verzahnt ineinander, um das komplexe Phänomen Genialität hervorzubringen.
Motivation
Motivation/-/motivation
Ein Motiv ist ein Beweggrund. Wird dieser wirksam, spürt das Lebewesen Motivation – es strebt danach, sein Bedürfnis zu befriedigen. Zum Beispiel nach Nahrung, Schutz oder Fortpflanzung.
Genies wie Einstein oder Mozart stellen wir uns gerne vor, wie sie im stillen Kämmerlein ganz aus sich selbst heraus schöpfen und im Alleingang die Relativitätstheorie oder die Jupitersymphonie „gebären“. Das ist eine ziemlich moderne Idee. Bis zur Epoche der Aufklärung war Genie nichts, was man in einem Individuum als dessen schöpferische Kraft verortete. Vielmehr war Genie eine von außen kommende Macht göttlicher Natur, die jeder Mensch von Geburt an innehatte. Vor allem die Idee einer Schöpfung aus dem Nichts kann man heute wieder in das Reich der Mythen verbannen. So gilt etwa der schweizerisch-italienische Ingenieur Michele Angelo Besso als einflussreichster Diskussionspartner Einsteins bei der Entstehung von dessen Spezieller Relativitätstheorie. Einstein schrieb selbst, „dass er ihm manche wertvolle Anregung verdanke“. Auch Genies brauchen Partner.
Je mehr Stars, je mehr Talent, desto mehr Erfolg. Eine Rechnung wie eine sichere Bank. Doch leider geht sie nicht ganz auf, wenn man sich die Ergebnisse einer Studie von 2014 von Roderick Swaab von der europäischen Business School INSEAD und seinen Kollegen anschaut. Beispiel Fußball: Zwar spiegelt der Erfolg einer Mannschaft tatsächlich die Zahl der Topspieler wieder – aber nur bis zu einem gewissen Punkt: Waren mehr als 60 Prozent einer Mannschaft Superstars, ging das zu Lasten der Teamleistung. Der Grund könnte in der Teamarbeit selbst liegen. Gerade beim Fußball müssen die Spieler alle an einem Strang ziehen, zu viele Stars in den eigenen Reihen scheinen die Teamarbeit aber eher zu behindern. Bei Sportarten wie Baseball, der mehr auf Einzelleistungen basiert, fanden die Forscher diesen Effekt aber nicht.
2016 stellte der usbekische Schachspieler Timur Gareyev einen neuen Weltrekord im Blindsimultanschach auf, als er gegen 48 Gegner simultan spielte und zwar mit verbundenen Augen. Auf diese Weise fuhr er 35 Siege und 7 Remis ein, 6 Partien verlor er. Der Neurowissenschaftler Jesse Rissman von der University of California in Los Angeles hat ihn in seinem Labor untersucht, um herauszufinden, wie der Blindschachmeister Dutzende von Schachbrettern im Gedächtnis behalten kann und auf jeden neuen Zug reagieren kann. Gareyev verfügt laut neurophysiologischen Tests nicht über ein überdurchschnittliches Arbeitsgedächtnis, und auch sein räumliches Vorstellungsvermögen und andere Gedächtnisfunktionen fallen normal aus; MRT-Aufnahmen ergaben allerdings: In Gareyevs Gehirn sind verschiedene Netzwerke wie das visuelle Netzwerk, das Kontroll- und das Aufmerksamkeitsnetzwerk besonders eng miteinander verbunden. So könne der Schachmeister seine Gedanken leichter kontrollieren und besser zwischen den verschiedenen Netzwerken hin und her wechseln, vermutet Rissman.
Auge
Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb
Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.
Gedächtnis
Gedächtnis/-/memory
Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im Organismus. Dazu gehören neben dem reinen Behalten auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf.
Der Koreaner Kim Ung-yong (IQ 210) war ein echter Frühentwickler: Bereits mit sechs Monaten vermochte er zu sprechen. Mit drei konnte er sich auf Koreanisch, Japanisch, Deutsch und Englisch unterhalten und komplexe Rechenaufgaben lösen. Im zarten Alter von acht Jahren begann er bei der NASA zu studieren. Als junger Erwachsener hatte er schon diverse Bücher publiziert, darunter allein zahlreiche Abhandlungen über Hydraulik. Heute betont er in Interviews immer wieder, dass es viel wichtiger sei, sich an den normalen Dingen des Lebens wie Freundschaften zu erfreuen, als besonders zu sein.
Intelligenzquotient
Intelligenzquotient (IQ)/-/intelligence quotient
Kenngröße, die das intellektuelle Leistungsvermögen eines Menschen ausdrücken soll. Entsprechende Tests zur Ermittlung der Intelligenz gehen mit dem Konzept einher, dass ein allgemeiner Generalfaktor der Intelligenz existiert, der in der Bevölkerung normal verteilt ist. Die ersten IQ-Tests wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von Alfred Binet entwickelt, der damit das relative Intelligenzalter von Schulkindern bestimmen wollte. Seiner Definition zufolge bezeichnet der IQ den Quotienten aus Intelligenzalter und Lebensalter multipliziert mit 100. Dies ist demnach auch der durchschnittliche IQ eines Menschen. 95 Prozent der Bevölkerung liegen mit ihren IQ-Werten zwischen 70 und 130. Erreicht jemand einen Wert unter 70, spricht man von Intelligenzminderung, während ein Ergebnis jenseits der 130 als Hochbegabung gilt.
2998 Lösungen landeten im Papierkorb von Thomas Edison – beim Versuch, ein funktionierendes elektrisches Licht zu basteln. Ein anderer verfehlte den Korb hingegen mehr als 9000 Mal alleine bei Punktspielen im Laufe seiner Karriere: der Basketballstar Michael Jordan. Auch zwei anerkannten Genies, der eine einer der innovativsten Erfinder in der Geschichte, der andere der vielleicht beste Basketballspieler aller Zeiten, gelingt nicht alles, – und vor allem nicht alles auf Anhieb. Das wirft die Frage auf, was geniale Menschen und ihre Leistungen ausmachen. Ist es wirklich Begabung oder vor allem harte Arbeit?
Seit mehr als zwei Jahrzehnten geistert eine große Zahl nicht nur durch die Fachliteratur, sondern auch die Populärkultur: Der Pfad auf dem Weg zu einem echten Meister eines Faches, sei es Musik, Schachspiel oder im Sport, solle ein steiniger sein, gepflastert mit mindestens 10.000 Stunden intensiver Übung. Die gute Nachricht dabei: Im Prinzip sei hierbei angeborene Begabung Nebensache. Doch holen wir zunächst ein klein wenig weiter aus. Bei der Frage, was große Geister ausmacht, schwingt seit 150 Jahren das Pendel zwischen zwei extremen Antworten hin und her: Es seien natürlich die Anlagen, behaupten die einen. Nein, mitnichten, es ist die Umwelt, entgegnen die anderen.
Exemplarisch haben wir auf der einen Seite Francis Galton (1822-1911), den Begründer der Verhaltensgenetik. Er vertrat im 19. Jahrhundert die Ansicht, dass Experten „geboren“ werden. Zwar sei „Training nötig, um einen hohen Grad an Leistung zu erreichen, aber angeborene Fertigkeiten begrenzen den äußersten Level an Leistung, den eine Person erreichen kann.“ Galton war beim Sichten von Familienstammbäumen aufgefallen, dass sich herausragende Leistungen in der Wissenschaft, in Kunst, Musik und Sport gehäuft in Familien finden, – und zwar in viel stärkerem Maße als es der Zufall erwarten lassen sollte. Galton stammte selbst aus einer solchen Familie. Nicht nur, dass er selbst auf vielen Gebieten wie der Geographie oder der Meteorologie glänzte. Er war auch der Cousin Charles Darwins, des Begründers der Evolutionstheorie. Und beide hatten Erasmus Darwin zum Großvater, einen der führenden Intellektuellen des 18. Jahrhunderts.
Die gegenteilige Position vertrat der amerikanische Psychologe John B. Watson (1878-1958), der Begründer des Behaviorismus, mit dem das Pendel Anfang des 20. Jahrhunderts in die andere Richtung schwang. Experten seien gemacht, glaubte Watson. “Intensiver als andere zu üben, … ist wahrscheinlich die vernünftigste Erklärung, die wir heute haben, nicht nur für Erfolg in jeder Hinsicht, sondern sogar für Genialität.“ Ganz im Geiste von Watson traten dann 1993 Forscher um den Psychologen K. Anders Ericsson von der Florida State University auf den Plan. Sie befragten professionelle Musiker unterschiedlicher Leistungsniveaus zu ihren Übungsstunden und kamen zu dem Ergebnis: Die Leistung von Experten auf einem bestimmten Gebiet lasse sich hauptsächlich durch die angehäuften Stunden von gezieltem Üben und nicht durch angeborenes Talent erklären. Die eingangs erwähnte 10.000-Stunden-Regel war geboren.
Durch das Buch „Überflieger“ des amerikanischen Autors Malcom Gladwell avancierte diese Regel zu einer bekannten Formel der Popkultur. Und es scheint ja etwas dran zu sein: Ob Mozart, Beethoven oder die Beatles – alle haben ihre großen Werke zustande gebracht, nachdem sie fünfstellige Übungsstunden absolviert hatten. „Ericsson ging ursprünglich davon aus, dass der Mensch wie ein unbeschriebenes Blatt ist“, sagt die Psychologin Tanja Gabriele Baudson von der TU Dortmund. Und im Prinzip jeder durch 10.000 Stunden Übung zu einem Experten werden könne. „Diese extreme Sicht, dass Begabung keinerlei Rolle spielt, ist jedoch nur schwer haltbar.
Doch mehr als nur Übung?
In der Tat war die doch recht einseitige Sicht in den letzten Jahren einem starken Gegenwind ausgesetzt, – beispielsweise durch eine Metaanalyse von Forschern um die Psychologin Brooke Macnamara von der Princeton University: In ihrer Auswertung diverser Studien konnte gezieltes Üben nur einen eher bescheidenen Teil der Unterschiede im Abschneiden auf vielen Gebieten wie Sport, Spiel (Schach) oder Musik erklären. Andere wichtige Faktoren könnten laut Macnamara und ihren Kollegen sein: Wann man mit dem Üben angefangen hat und welche Intelligenz man mitbringt. Intelligenz sei in erheblichem Maße erblich und könne das Leistungsniveau in vielen Bereichen wie Musik, Schach oder den Wissenschaften vorhersagen.
In diese Richtung weist auch eine vor mehr als 45 Jahren begonnene Langzeitstudie, heute geleitet von Forschern der Vanderbilt University. Sie begleitet rund 5000 intellektuell begabte, frühreife Kinder. Und sie lässt wenig Zweifel daran, dass Expertentum zu einem großen Teil mit Begabung zu tun hat. Viele der heutigen Innovatoren in Wissenschaft, Technologie und Kultur waren früher mathematisch oder sprachlich begabte Kinder. Die Bedeutung der Intelligenz bestätigt auch Klaus Urban, Leiter des Instituts für angewandte Begabungsdiagnostik und Begabungsförderung Hannover. „In allen Leistungsbereichen, seien sie nun eher intellektuell ausgerichtet, aber auch im Talentbereich, bei Sport, Musik oder Kunst, da spielt Intelligenz immer eine gewisse Rolle“, sagt der pädagogische Psychologe und emeritierte Professor an der Universität Hannover. „Ich muss schließlich unter anderem erfassen, was in dem jeweiligen Bereich, beispielsweise in der Kunst bereits zuvor erarbeitet und geleistet wurde.“ Und auch um das bisher in einer Domäne Erreichte weiterzuentwickeln, benötige man Intelligenz.
Eine weitere Studie relativiert indes diese Einschätzung: „Braucht Schach Intelligenz?“ fragte Merim Bilalic von der Northumbria University. In seiner Langzeitbeobachtung fand er heraus, dass es nicht die Kinder mit den allerhöchsten Intelligenzquotienten waren, die sich später als die besten Schachspieler erwiesen. Vermutet wird, dass die „Überflieger“ noch zu viele andere Hobbys gepflegt haben und nicht so viel intensive Übungszeit in Schach gesteckt hatten, wie Altersgenossen mit etwas niedrigeren IQ-Werten.
Intelligenz
Intelligenz/-/intelligence
Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Dem britischen Psychologen Charles Spearman zufolge sind kognitive Leistungen, die Menschen auf unterschiedlichen Gebieten erbringen, mit einem Generalfaktor (g-Faktor) der Intelligenz korreliert. Demnach lasse sich die Intelligenz durch einen einzigen Wert ausdrücken. Hierzu hat u.a. der US-Amerikaner Howard Gardner ein Gegenkonzept entwickelt, die „Theorie der multiplen Intelligenzen“. Dieser Theorie zufolge entfaltet sich die Intelligenz unabhängig voneinander auf folgenden acht Gebieten: sprachlich-linguistisch, logisch-mathematisch, musikalisch-rhythmisch, bildlich-räumlich, körperlich-kinästhetisch, naturalistisch, intrapersonal und interpersonal.
Intelligenzquotient
Intelligenzquotient (IQ)/-/intelligence quotient
Kenngröße, die das intellektuelle Leistungsvermögen eines Menschen ausdrücken soll. Entsprechende Tests zur Ermittlung der Intelligenz gehen mit dem Konzept einher, dass ein allgemeiner Generalfaktor der Intelligenz existiert, der in der Bevölkerung normal verteilt ist. Die ersten IQ-Tests wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von Alfred Binet entwickelt, der damit das relative Intelligenzalter von Schulkindern bestimmen wollte. Seiner Definition zufolge bezeichnet der IQ den Quotienten aus Intelligenzalter und Lebensalter multipliziert mit 100. Dies ist demnach auch der durchschnittliche IQ eines Menschen. 95 Prozent der Bevölkerung liegen mit ihren IQ-Werten zwischen 70 und 130. Erreicht jemand einen Wert unter 70, spricht man von Intelligenzminderung, während ein Ergebnis jenseits der 130 als Hochbegabung gilt.
Recommended articles
Aha-Momente mit Vorlaufzeit
Zudem hat die mit konventionellen Intelligenztests erfasste Intelligenz ab einem bestimmten Punkt ihre Grenzen. Wer nach herkömmlichen IQ-Tests besonders schlau ist, muss nicht kreativ sein. „Will ich aber etwa in Kunst oder Musik etwas Außergewöhnliches leisten, muss ich eine ordentliche Portion Kreativität mitbringen“, betont Klaus Urban. „Nur so kann ich über das konventionelle Denken hinausgehen, – sonst könnte ich nie etwas Neues leisten, neue Pfade betreten.“ Es ist allerdings nach Urban zu kurz gegriffen, Kreativität hierbei nur als divergentes Denken (https://www.dasgehirn.info/wahrnehmen/schoenheit/im-kopf-des-kuenstlers-6707) zu bestimmen und dabei quantitativ zu erfassen, wie viele Ideen eine Person etwa dazu hat, was man alles mit einem Backstein anfangen könnte. „Zur Kreativität gehören auch noch andere Aspekte wie Gestaltungswille, Fokussierung, Anstrengungsbereitschaft und vor allem Motivation, die ich mitbringen muss, um schöpferisch zu sein.“ So zeigt die Kreativitätsforschung: Selbst die scheinbar aus dem Nichts, manchmal regelrecht im Schlaf auftauchenden Eingebungen, die berühmten Heureka-Momente, haben eine lange Vorlaufzeit. Soll es sich um wirklich sinnvolle Eingebungen handeln, muss man sich zuvor systematisch mit dem Gebiet beschäftigen und auch über genügend Expertise verfügen.
Geniale Leistungen basieren also vielfach gleich auf einem ganzen Geflecht von Voraussetzungen: ein gewisses Maß an kognitiven Fertigkeiten, Charaktereigenschaften wie Motivation und Neugier, Umweltfaktoren wie die richtige Förderung und viel Übung. Der ewige Streit – Umwelt oder Anlage – ist heute eigentlich veraltet. „Es macht keinen Sinn, zu fragen, wie viel Prozent des Potenzials auf die Gene zurückzuführen sind“, sagt Tanja Gabriele Baudson. „Der Grund: Anlagen und Umwelt interagieren stark miteinander.“ Ähnlich sieht es Klaus Urban. Wie bei allen Fähigkeiten spiele auch bei Talent Anlage und Umwelt zusammen, und zwar von Beginn an. „Es ist wesentlich, ob eine bestimmte Anlage bei einem Kind erkannt und gefördert wird, ob die betreffende Person übt, damit sich daraus später Hochleistung ergibt.“
Intelligenz
Intelligenz/-/intelligence
Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Dem britischen Psychologen Charles Spearman zufolge sind kognitive Leistungen, die Menschen auf unterschiedlichen Gebieten erbringen, mit einem Generalfaktor (g-Faktor) der Intelligenz korreliert. Demnach lasse sich die Intelligenz durch einen einzigen Wert ausdrücken. Hierzu hat u.a. der US-Amerikaner Howard Gardner ein Gegenkonzept entwickelt, die „Theorie der multiplen Intelligenzen“. Dieser Theorie zufolge entfaltet sich die Intelligenz unabhängig voneinander auf folgenden acht Gebieten: sprachlich-linguistisch, logisch-mathematisch, musikalisch-rhythmisch, bildlich-räumlich, körperlich-kinästhetisch, naturalistisch, intrapersonal und interpersonal.
Motivation
Motivation/-/motivation
Ein Motiv ist ein Beweggrund. Wird dieser wirksam, spürt das Lebewesen Motivation – es strebt danach, sein Bedürfnis zu befriedigen. Zum Beispiel nach Nahrung, Schutz oder Fortpflanzung.
Gen
Gen/-/gene
Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.
Umwelt x Anlage = Talent
Wie eng Anlage und Umwelt zusammenspielen, zeigt einmal mehr das Beispiel kreativer Menschen. Sie kommen oft aus einem stimulierenden Elternhaus, das sie mit Büchern, Museumsbesuchen und musikalischen Hörgenüssen im Überfluss versorgt. Ein klares Beispiel für den Einfluss der Umwelt, mag man denken. Doch weit gefehlt. Denn der Nachwuchs schafft sich teilweise erst selbst die Umwelt, die seine auch genetisch mitbedingten Fertigkeiten und Interessen verlangen. Es sind vielfach die begabten Kleinen, die ihre Eltern drängen, ihnen bestimmte Bücher zu kaufen, sie in den Genuss von Musikunterricht kommen zu lassen oder ihnen den Tennisunterricht zu bezahlen. Der später berühmte Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) widmete sich als Kind heimlich dem Studium der Mathematik, selbst als sein Vater alle Bücher zu dem Thema versteckte, weil er glaubte, sein Sohn würde seine klassischen Studien vernachlässigen. Kurzerhand erschuf der junge Pascal große Teile der bereits bestehenden Euklidischen Mathematik auf eigene Faust.
Zum Weiterlesen:
- Macnamara BN, Hambrick DZ, Oswald FL: Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: a meta-analysis.
- Psychol Sci. 2014 Aug;25(8):1608-18. doi: 10.1177/0956797614535810
- Cosmelli D, Preiss DD.: On the temporality of creative insight: a psychological and phenomenological perspective. Front Psychol. 2014 Oct 17;5:1184. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01184. eCollection 2014.